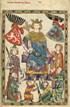Wenzel
II. (Böhmen)
Wenzel
II. von Böhmen als Minnesänger (Codex Manesse,
14. Jh.)
Wenzel II. (tschechisch
Václav, polnisch Wacław) (* 27. September 1271; † 21. Juni 1305 in Prag) war ab 1278 König
von Böhmen und ab 1300 als Wenzel I. König von Polen. Er war der
vorletzte Herrscher aus der Dynastie der Přemysliden.
Als Kind lebte er von 1279 bis 1283
in Gefangenschaft seines Vormunds Otto V. in Brandenburg.
Nach seiner Rückkehr stand der jugendliche König in Prag bis 1288 unter dem
Einfluss des Witigonen Zawisch von Falkenstein. Als regierender
König erwarb er zur böhmischen 1300 die polnische und von 1301 bis 1303 für
seinen Sohn Wenzel III. die ungarische Krone.
Im Gegensatz zu seinem Vater Přemysl Ottokar II. war Wenzel II. kein Eroberer, sondern
vor allem Diplomat. Deshalb galt er der Nachwelt bis in das 20. Jahrhundert als
schwacher Herrscher, der seine Erfolge vor allem dem Geld verdankte und
ansonsten von seinen Ratgebern abhängig war.[1] Als Herrscher über die böhmischen
Silberminen verfügte er über genügend Mittel, um sich in der europäischen
Politik zu behaupten und Böhmen eine langjährige Friedenszeit zu sichern.
Inhaltsverzeichnis
·
1 Geburt
·
5 Tod
Geburt[Bearbeiten]
Wenzel wurde 1271 als lang erwarteter
Thronfolger König Přemysl Ottokars II. auf der Prager Burg geboren. Sein Vater war seit 1253
König von Böhmen und hatte zudem ab 1251 die Macht in den Herzogtümern Österreich, Steiermark, Kärnten und Krainerworben. Dessen
erste Ehe mit Margarethe von Babenberg blieb kinderlos. Von den Kindern, die
dessen zweite Frau Kunigunde von Halitsch zur Welt brachte, lebten 1271 nur noch
zwei Mädchen: Kunigunde und Agnes. Wenzel war bei seiner
Geburt der einzige legitime Sohn und Erbe eines Territoriums, das vom
Riesengebirge bis zur Adria reichte.
Das Reich Přemysl Ottokars II.
zerbrach jedoch am Konflikt mit dem römisch-deutschen König Rudolf I. von
Habsburg. Bereits dessen Wahl 1273 hatte der böhmische König
abgelehnt, und er widersetzte sich auch der Forderung, sich seine Länder alsReichslehen bestätigen zu lassen. 1275 verhängte
Rudolf über ihn die Reichsacht.
Die Feindschaft eskalierte 1276 in einen bewaffneten Zusammenstoß, in dem
Přemysl unterlag. Er verlor bis auf seine Erbländer alle Territorien und
musste Rudolf zwei Kinder versprechen: Kunigunde wurde zur Ehefrau für Rudolfs
Sohn Hartmann bestimmt,
Wenzel sollte eine Tochter des Habsburgers heiraten. Die Beziehung beider
Herrscher verschlechterte sich dennoch weiter und endete 1278 mit der Schlacht auf dem Marchfeld, in der
Přemysl Ottokar II. fiel. Der siebenjährige Wenzel war zum König von
Böhmen geworden.
Geiselhaft[Bearbeiten]
Auf
der Burg Bezděz verbrachte Wenzel II. 1279 die ersten Monate seiner
Gefangenschaft
Zum Vormund hatte Přemysl
Ottokar II. vor der Schlacht seinen Neffen Markgraf Otto V. von Brandenburg vorgesehen, der im Spätsommer 1278 dem
Ruf der Königinwitwe folgte und mit einem mehrere hundert Mann starken Heer in
Böhmen einrückte. Die Regentschaft Ottos entwickelte sich rasch zur
Schreckensherrschaft. Die Brandenburger Truppen plünderten das Land. Der
Markgraf hatte nach kurzer Zeit den Adel, die Kirche und die Königinwitwe gegen
sich. Kunigunde bat zwar bereits im Oktober 1278 Rudolf von Habsburg um
Vermittlung, doch die Verhandlungskommission bestätigte Otto als Vormund und
Herrscher über Böhmen. Mähren behielt Rudolf für die Dauer von fünf
Jahren in seiner Gewalt. Um seine Macht abzusichern, ließ Otto von Brandenburg
sein Mündel im Januar 1279 aus Kunigundes Residenz in der Stadt in die Prager
Burg bringen. Doch reichte dies nicht: am 4. Februar wurde Wenzel mit seiner
Mutter auf die Burg Bezděz überführt. Von diesem Zeitpunkt an war
der junge König Geisel des Regenten.
Die Königin wurde offenbar nicht
gefangen gehalten. Sie verließ die Burg nach etwa zwei bis drei Monaten in
Richtung Troppau, wo ihre
Witwengüter lagen. Wenzel blieb in Ottos Gewalt. Im Spätsommer 1279 brachte der
Markgraf den König außer Landes: die Reise führte über Zittau und Berlin in die Askanierburg Spandau,
wo der Gefangene Ende Dezember eintraf und bis 1282 blieb. Das Bild der
Brandenburger Gefangenschaft Wenzels war lange von der zeitgenössischen
Schilderung der Königssaaler Chronik geprägt,
nach der er hungrig und zerlumpt in Elend gehalten worden sei – ein
hagiographisches Element, das so nicht aufrechterhalten werden kann.
Tatsächlich blieben Wenzel II. und Otto V. auch später in engem Kontakt, und es
scheint, als habe der König gerade in jener Zeit die Grundlagen seiner Bildung
erworben. Er sprach später fließend Deutsch und Latein, besaß Kenntnisse der
Theologie, des Rechts und der Medizin und verfasste Verse. Lesen und Schreiben
lernte er jedoch nicht.
Ins Elend stürzte während der
Brandenburger Herrschaft dagegen das Land. In den Jahren 1281–1282 ereignete
sich in Böhmen, verursacht durch andauernde Kämpfe und zwei Missernten, eine
der schlimmstenHungersnöte des
Mittelalters. Das Land wurde von Söldnern und Räuberbanden heimgesucht und
drohte im Chaos zu versinken. Vertreter des Adels, der Geistlichkeit und
einiger Städte nahmen Verhandlungen mit Otto auf, um den König wieder ins Land
zu holen und die bedrohliche Situation abzuwenden. Diese Verhandlungen weisen
auf eine grundlegende Veränderung der staatlichen Ordnung hin. Der Adel trat – in Abwesenheit einer zentralen
Macht – erstmals geschlossen als Repräsentant des Landes auf und übernahm
Verantwortung für dessen Schicksal. Die ersten Einigungsversuche im Frühjahr
1282 scheiterten an der Höhe des Lösegeldes.
Otto brachte seine Geisel nach Prag, verlangte aber statt der ursprünglichen
15.000 zusätzliche 20.000 Pfund Silber. Wenzel wurde erneut
fortgeführt und verbrachte ein weiteres Jahr in Dresden am Hof des Markgrafen von Meißen. Erst
als die Verhandlungsführer dem Markgrafen einen Teil Nordböhmens als Pfand
versprachen, ließ Otto den Gefangenen frei. Am 24. Mai 1283 kehrte Wenzel nach
Prag zurück.
Zawisch
von Falkenstein[Bearbeiten]
Das
Siegel des Zawisch von Falkenstein
Prag feierte die Rückkehr des Königs
im Mai 1283 begeistert, selbständig regieren konnte der knapp Zwölfjährige noch
nicht. Die adlige Gruppe, die sich für seine Freilassung eingesetzt hatte,
teilte die höchsten Hofämter untereinander auf. Hofmeister und damit Erzieher und Vertreter des
Königs wurde ihr Anführer Purkart von Janowitz. Die
Konstellation hatte nur wenige Monate Bestand. Noch im Verlauf des Jahres 1283
rief Wenzel seine Mutter Kunigunde nach Prag zurück, und mit ihr kam Zawisch von Falkenstein an den Hof. Die Karriere des
Burggrafen aus dem einflussreichen südböhmischen Geschlecht der Witigonen hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits
einige außergewöhnliche Wendungen durchlaufen: 1276 hatte er eine Rebellion
gegen Přemysl Ottokar II. angeführt. 1280 trat er in Oppeln in den Dienst
der Königinwitwe und beteiligte sich am Widerstand gegen die brandenburgische
Regentschaft. Nach Prag kam er 1283 als Kunigundes Ehemann und Vater ihres
jüngsten Sohnes Jan. Die ungleiche Ehe, noch dazu heimlich, ohne Wissen der
Familien eingegangen, war ein Skandal, doch da vollzogen, war sie nach
damaligem Recht gültig. Der junge König akzeptierte die Verbindung, und
Kunigunde überließ Zawisch Wenzels Erziehung. Der Wittigone war damit faktisch
zum Herrscher des Landes aufgestiegen. Er übernahm selbst kein Amt, doch noch
im Winter 1283/1284 besetzte er alle wichtigen Hofposten mit seinen Verwandten
und Parteigängern. Die entmachtete Adelsgruppe ging zum bewaffneten Widerstand
über, musste aber im Mai 1284 einen vierjährigen Waffenstillstand akzeptieren.
Die offizielle Eheschließung holten Zawisch und Kunigunde zu einem
nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen 1283 und 1285 nach.
Auch wenn die Macht Zawischs in
Böhmen unangreifbar schien, für den Hof des römisch-deutschen Königs blieb der
Aufsteiger inakzeptabel. Dies zeigte sich deutlich in Verlauf von Wenzels
eigener Eheschließung mit Guta von
Habsburg. Die beiden wurden bereits 1278/1279 verlobt,
möglicherweise auch schon verheiratet.
Vollzogen werden konnte die Ehe aber erst im Januar 1285 bei einem Treffen der
Familien in Eger, als Braut und Bräutigam
13 Jahre und damit so gut wie volljährig waren. Wenzel leistete bei der
Gelegenheit dem Schwiegervater auch den Lehnseid für seine Erbländer. Zawisch war bei
der Zeremonie nicht anwesend, und als Rudolf I. Eger verließ, nahm er seine
Tochter wieder mit. Erst im Sommer 1287 gab der Habsburger dem Drängen der
böhmischen Seite nach und die Königin zog mit ihrem Gefolge auf dem Prager Hof
ein. Ein Jahr später nahm Wenzel II. die Regierungsgeschäfte in eigene Hand.
Eine seiner ersten selbständigen Amtshandlungen war im Jahr 1288 eine Verschwörung gegen seinen Stiefvater, der gerade,
drei Jahre nach Kunigundes Tod, eine neue Ehe eingegangen war und dessen
freiwilliger Verzicht auf die Macht im Land nicht zu erwarten war. Wenzel ließ
Zawisch unter einem Vorwand in die Burg rufen und nahm ihn gefangen. Nach
zweijähriger Kerkerhaft starb Zawisch von Falkenstein 1290 vor
der Burg Hluboká durch das Schwert. Der tiefgläubige
König soll schwer an seiner Entscheidung getragen haben. Das
Zisterzienserkloster Zbraslav gründete er nach Aussage
zeitgenössischer Quellen als Sühne für seinen Verrat.
Herrschaft[Bearbeiten]
Sowohl der Vergleich mit seinem
charismatischen Vater Přemysl Ottokar II., als auch die spektakulären und
skandalträchtigen Ereignisse in der Jugend Wenzels II. haben das Urteil über
den König jahrhundertelang geprägt. Er galt als ein schwacher Herrscher, seine
Persönlichkeit wurde als neurotisch bis krankhaft beschrieben, das Interesse an
seiner Regierungszeit war gering. So urteilte bereits sein Zeitgenosse Dante Alighieri über Vater und Sohn:
Hieß Ott’kar, der, mit Windeln noch
umkleidet,
Besser als Wenzeslaus, sein Sohn, erschien,
Der Bärt’ge, der an Üppigkeit sich weidet.[2]
Politisch und ökonomisch erlebte
Mitteleuropa in den Jahren 1290–1305, in der Zeit Wenzels II. selbständiger
Regierung, allerdings eine Phase der Ruhe und Stabilität. Im Gegensatz zu
seinen Vorgängern pflegte der König einen Regierungsstil, der auf fachkundige
Berater und Diplomatie statt auf Krieg und Eroberung setzte.
Den Besitz seines Vaters in den Alpenländern konnte er nicht wiedererlangen.
Das Hauptaugenmerk böhmischer Außenpolitik richtete er nach Norden: Auf die Markgrafschaft Meißen, das Pleißenland und besonders nach Polen. Als Kurfürst war er auch einer der Hauptakteure in
der Politik des Heiligen Römischen Reiches. Die
römisch-deutschen Könige Rudolf I., Adolf von Nassau und Albrecht I. waren seine Lehnsherren. Der Reichtum
und die Macht der böhmischen Krone ließ sie zu seinen Verhandlungspartnern und
oft auch zu Gegnern werden.
Böhmen[Bearbeiten]
König
Wenzel II. erteilt demKuttenberger Bergwerk
seine Bergordnung.
Prager
Groschen
Wenzel II. übernahm von seinem
Stiefvater eine relativ gefestigte Herrschaft. Um das Land endgültig zu
befrieden und den erstarkten Adelsstand in Schach zu halten, stützte sich der
König auf seinen Hof und hier vor allem auf geistliche Ratgeber. Die
Außenpolitik legte er in die Hände erfahrener Diplomaten: Zunächst
verpflichtete er Bischof Arnold von
Bamberg (1290–92),
dann Bernhard von Kamenz (1292–1296) und schließlich Peter von Aspelt (1296–1304).
Wirtschaftlich hatte sich die Lage
nach dem Niedergang während der Brandenburger Zeit um 1290 wieder stabilisiert.
Der Landesausbau während der Binnenkolonisation im
13. Jahrhundert und vor allem die neuerschlossenen ergiebigen Silbervorkommen in Kutná Hora schufen Voraussetzungen für wirtschaftlichen
Aufschwung. Bereits vor 1300 wurde hier 41 % des europäischen und
90 % des böhmischen Silbers gefördert. Um die Arbeit in den Bergwerken und
damit seine wichtigste Einnahmequelle zu regeln, gab Wenzel II. zwischen 1300
und 1305 das Ius regale montanorum in Auftrag, ein Bergrecht, das zumindest
in Teilen bis 1854 gültig blieb. 1300 führte er eine Münzreform durch, um die Qualität der Währung zu
heben. Der neue Prager Groschen setzte sich wegen seines stabilen
Wertes auch im benachbarten Ausland durch. Der Prager Hof blieb unter König
Wenzel II. wie schon unter seinem Vater ein kulturelles Zentrum, besonders der
zeitgenössischen deutschen Literatur. Ulrich von Etzenbach widmete Wenzel II. einen Alexanderroman in 30.000 Versen, und vom König selbst
sind in der Manessischen
Liederhandschrift drei Minnelieder erhalten.
Zum glanzvollen Höhepunkt und
Machtdemonstration des königlichen Paares sollte die Krönung werden. Sie musste mehrfach verschoben
werden und fand daher erst im Jahr 1297 statt. Das Fest endete tragisch: Am
siebzehnten Tag nach der Krönung starb Königin Guta an Erschöpfung bei der
Geburt ihres zehnten Kindes. Der Fortbestand der Dynastie war trotz der hohen
Kinderzahl nicht ausreichend gesichert. Fünf Kinder starben als Säuglinge. Drei
Töchter konnte Wenzel II. zum Knüpfen diplomatischer Bündnisse einspannen:
Agnes wurde mit Ruprecht von Nassau, Anna mit Heinrich von Kärnten und Margarethe mit Boleslaw von Liegnitz vermählt. Elisabeth, ursprünglich
wohl für den geistlichen Stand bestimmt, blieb zu Lebzeiten ihres Vaters ledig.
Nur ein Sohn, der künftige König Wenzel III., erreichte das
Erwachsenenalter.
Polen[Bearbeiten]
Kurz nach seiner Regierungsübernahme
schaltete sich Wenzel II. in die Machtkämpfe in Polen ein. Das
in Herzogtümer zersplitterte Königreich erlag ab dem 12. Jahrhundert sukzessive
dem feudalen Partikularismus.
Wenzel begann, systematisch Verbündete zu suchen und die Teilherrschaften unter
seine Kontrolle zu bringen. 1289 leistete ihm mit Kasimir von Beuthen der erste polnische Herzog für sein Herzogtum den Lehnseid. 1291 gewann er die
Oberhoheit über einen Großteil des Herzogtums Oppeln und das Herzogtum Krakau und ging ein Bündnis mit Herzog
Bolesław III. von Masowien ein,
dem er seine Schwester Kunigunde zur Frau gab. 1292 eroberte er das von Herzog Władysław Ellenlang von Kujawien, seinem mächtigsten polnischen
Widersacher, gehaltene Herzogtum Sandomir, und war nun die
stärkste Kraft in der Provinz Kleinpolen.
Wenzel
II. mit böhmischer und polnischer Krone. Abbildung aus dem Chronicon Aulae
Regiae
Einen Rückschlag erlitt die Politik
Wenzels II. 1295, als Herzog Przemysław
II., stärkster Mann in Großpolen und Pommerellen,
überraschend zum polnischen König gekrönt wurde. Dieser fiel jedoch bereits ein
Jahr später einem Mordanschlag zum Opfer. Als sein Nachfolger setzte sich
Władysław Ellenlang in seiner Eigenschaft als Herzog von Großpolen
und Pommerellen zunächst durch. 1299 schloss der verschuldete Herzog einen Vertrag
mit Wenzel II., in dem er sich gegen eine Geldzahlung verpflichtete, dem
böhmischen König den Lehnseid zu leisten. Er hielt die Vereinbarung nicht ein,
daraufhin zwang ihn der Böhme 1300 ins Exil. Wenzel II. setzte sich damit,
neben dem Besitz von Kleinpolen, auch als Herrscher in den Provinzen Großpolen,
Pommerellen, Kujawien und Mittelpolen mit den Hauptburgen Sieradz und Łęczyca durch. Nur einzelne polnische
Territorien lagen ab da noch außerhalb seiner unmittelbarer Macht, zum Beispiel
das mit ihm verbündete Masowien. Vorsichshalber
holte Wenzel II. noch die Zustimmung seines eigenen Lehnsherrn, des
römisch-deutschen Königs Albrechts I. ein, und er hielt um die Hand Rixas an,
der einzigen Tochter des verstorbenen Königs Przemysław. Als beides
positiv ausfiel, marschierte Wenzel II. erneut mit einem Heer in Polen ein. Die
bewaffnete Begleitung diente nur der Machtdemonstration, denn ernsthaften
Widerstand gab es nicht mehr. Gekrönt wurde er im August 1300 in Gnesen durch Erzbischof Jakub
Świnka. Seine Herrschaft sicherte er mit einer Reihe von
Verwaltungsreformen. Unter anderem führte er das Amt eines Starosten als königlichen Vertreter ein, das
auch nach seinem Tod in Gebrauch blieb. Bis Ende 1300 blieb der neue polnische
König in seinem Königreich, dann zog er zurück nach Prag. Er betrat Polen nie
wieder.
Die zweite Frau des Königs war im
Jahr 1300 zwölf Jahre alt. Trotz dieses bereits ausreichenden Alters gab es
zunächst keine Eheschließung, sondern nur eine Verlobung. Anschließend schickte
Wenzel das Mädchen zu seiner Tante Griffina auf die Burg Budyně.
Erst 1303 wurde die Ehe vollzogen, und Rixa, die nach der Heirat den Namen
Elisabeth annahm, wurde Mutter von Wenzels jüngster Tochter Agnes. Warum Wenzel
II. nach Gutas Tod sechs Jahre Witwer geblieben war, anstatt sich um weitere
legitime Söhne zu sorgen, ist unklar. Glaubt man dem Verfasser der
Österreichischen Reimchronik, so herrschten in diesen Jahren lockere Sitten am
Prager Hof, wilde Feste wurden gefeiert und eine Geliebte Wenzels namens Agnes
gab den Ton an. Einen Thronfolger für die beiden Königreiche gab es immerhin
bereits.
Ungarn[Bearbeiten]
Kurz vor dem Tod Wenzels II. kam mit Ungarn noch ein drittes Kronland in den
Besitz der Přemysliden. Thronfolger Wenzel III. wurde bereits 1298 mit der
ungarischen Prinzessin Elisabeth verlobt. Als deren VaterAndreas III. 1301 starb, erhob unter anderem auch
Karl Robert von Anjou Ansprüche auf den Thron. Die Magnaten entscheiden sich aber für die
Přemysliden und trugen dem böhmischen König die Stephanskronean.
Wenzel II. zögerte, die finanzielle Belastung und das Risiko waren groß. Doch
schließlich sagte er zu und sandte seinen Sohn nach Ungarn. Im Mai 1301 fand in Buda die Wahl und im August in Székesfehérvárdie Krönung statt. Um seine Abstammung von den Arpaden zu verdeutlichen, nahm Wenzel III. den
Namen Ladislaus V. an.
Die ungarische Herrschaft scheiterte
nach zwei Jahren am Veto des Papstes Bonifatius VIII. und an Albrecht von Habsburg, die
beide die Machtfülle der Přemysliden zu vermindern suchten. Der Papst
verhielt sich zunächst neutral, doch am 31. Mai 1303 erklärte er Karl von Anjou
zum rechtmäßigen König von Ungarn. Bonifatius VIII. starb zwar im September
1303, an der Situation für die böhmischen Könige änderte sich auch unter seinem
Nachfolger Benedikt XI. jedoch nichts. Wenzel II. sah sich
gezwungen, mit dem römisch-deutschen König in Verhandlungen zu treten. Dessen
Bedingungen waren unannehmbar: Albrecht verlangte den Verzicht auf die
ungarische und polnische Krone, der territorialen Ansprüche auf Eger, Meißen und
dieOberpfalz sowie eine Beteiligung an den
Silberbergwerken in Kutná Hora. Als Wenzel II. einen solchen Ausgleich
ablehnte, wurde Ende Juni 1304 über ihn die Reichsacht ausgesprochen, und ein
Kampf der beiden Mächte stand bevor. Im Frühjahr 1304 zog Wenzel II. zunächst
seinem Sohn zur Hilfe. Dessen wichtigster Berater hatte das Land verlassen
müssen, der junge König war faktisch ein Gefangener im eigenen Land. Der
bewaffnete Zusammenstoß blieb zwar aus, doch die Magnaten wechselten die Seiten
und versagten dem gewählten König ihre Unterstützung. Nach zwei Monaten zog
sich Wenzel II. mit seinem Sohn mit nach Prag zurück und gab Ungarn auf. Bei
seiner Rückkehr erkrankte der König. Die Anstrengungen des Feldzuges brachten
den Ausbruch der Tuberkulose mit sich.
Die letzte Auseinandersetzung musste
Wenzel II. wenige Monate später bestehen. Im August 1304 fiel Albrecht von
Habsburg und seine Verbündeten, kumanische Reitertrupps, in Mähren ein. Der
böhmische und mährische Adel stand geschlossen auf Seiten seines Königs, doch
Wenzel II. ließ sich auch diesmal nicht zum Kampf provozieren. Das Heer des
Habsburgers wurde dennoch aufgerieben: Zunächst vergifteten die Bergleute in
Kutná Hora das Trinkwasser der Feinde mit Silberstaub, und als Albrecht wegen
des beginnenden Winters zum Abzug rüstete, griffen die böhmischen Truppen die
Heimkehrer an. Die Friedensverhandlungen im Jahr 1305 bereitete Wenzel noch
vor, den Friedensschluss erlebte er aber nicht mehr.
Tod[Bearbeiten]
Initiale
aus dem Chronicon Aulae Regiae mit einer Miniatur Wenzels II.
Der König lag ein halbes Jahr im
Sterben. Da seine Residenz in der Burg 1303 ausgebrannt war, lag der Kranke im
Haus des Goldschmieds Konrad in der Prager Altstadt.
Die Königssaaler Chronik schildert ausführlich, wie der Sterbende seine
Angelegenheiten ordnete: er bezahlte seine Schulden, versorgte seine Witwe und
gab einen Teil seines Vermögens der Kirche und den Armen. Dann tat er Buße.
Nach seinem Tod am 21. Juni 1305 wurde sein Leib mit dem Schiff in das Kloster
Zbraslav gebracht und in vollem königlichen Ornat in der Klosterkirche
beigesetzt. Der Bericht über den Tod des Königs konnte als
Argumentationsgrundlage für seine spätere Heiligsprechung verfasst worden sein. Zu diesem
Schritt kam es nicht.
Wenzel II. war der vorletzte
Přemyslidenkönig. Mit seinem Sohn und Nachfolger Wenzel III., der bereits
1306 einem Mordanschlag zum Opfer fiel, starb die Dynastie nach über
400-jähriger Herrschaft über Böhmen in der königlichen Linie aus.
Literatur[Bearbeiten]
·
Verwendete
Literatur:
·
Charvátová,
Kateřina. Václav II. Král
český a polský. Praha :
Vyšehrad, 2007. ISBN
978-80-7021-841-9.
·
Žemlička,
Josef u. U. Schulze: Wenzel
II. in: Lexikon des
Mittelalters 8 (1977), sp. 2188-2190
·
Weiterführende
Literatur:
·
Příběhy
krále Přemysla Otakara II. Zlá léta po smrti krále Přemysla Otakara
II. Praha : Nakladatelství Vyšehrad, 1947.
·
Jan, Libor: Václav II. a struktury panovnické
moci. Brno : Matice moravská, 2006. ISBN
80-86488-27-6.
·
Šusta, Josef: Dvě knihy českých
dějin. Kus středověké historie našeho kraje. 2. Bände,
Praha : Argo, 2001 und 2002. ISBN
80-7203-376-X (Bd. 1), ISBN
80-7203-377-8 (Bd. 2)
·
Adolf Bachmann: Wenzel II.. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 42, Duncker &
Humblot, Leipzig 1897, S. 753–756.
·
Quellen:
·
Chronicon Aulae
Regiae (1311–1339): Die Königsaaler Geschichtsquellen. Mit den Zusätzen und der
Fortsetzung des Domherrn Franz von Prag. Hg. Johann Loserth, Wien 1875,
Nachdruck in der Schriftenreihe Fontes rerum Austriacarum : Abt. 1,
Scriptores ; 8, Graz 1970
·
Ottokars
Österreichische Reimchronik: Monumenta
Germaniae Historica : [Scriptores. 8], Deutsche Chroniken = (Scriptores
qui vernacula lingua usi sunt) ; 5,1
Weblinks[Bearbeiten]
![]() Commons:
Wenzel II. – Sammlung von Bildern, Videos und
Audiodateien
Commons:
Wenzel II. – Sammlung von Bildern, Videos und
Audiodateien
Anmerkungen[Bearbeiten]
1.
↑ Charvátová, Kateřina: Václav II. Král
český a polský, S. 9-11.
2.
↑ Dante Aligihieri: Göttliche Komödie,
Siebenter Gesang, in der Übersetzung von Carl Streckfuß, Leipzig 1876
|
Vorgänger |
Amt |
Nachfolger |
|
König von Böhmen |
||
|
König von Polen |
Normdaten (Person): GND: 100700233 | LCCN: no2007121094 |